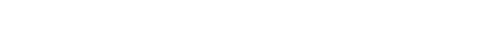Promilletester-Kaufberatung:
So finden Sie das passende Produkt
Das Wichtigste in Kürze:
- Alkoholkonsum beeinträchtigt unter anderem die Konzentration, führt zu Gleichgewichtsstörungen, verleitet zur Risikobereitschaft und verlängert die Reaktionszeit.
- Fahren unter Alkohol ist generell nicht ratsam, wird aber bei verschiedenen Promille-Werten unterschiedlich hart sanktioniert.
- Ein Alkoholtester kann zwar die Entscheidung, ob noch gefahren werden darf, niemals rechtssicher anzeigen, aber eine gute Entscheidungshilfe darstellen.
- Neben den günstigen Einmal-Blasröhrchen gibt es auch mehrfach verwendbare, elektronische Varianten mit Digitaldisplay.
Was ist ein Alkoholtester?
Ein Alkoholtester oder auch Alkomat misst den Alkoholgehalt der Atemluft. Solche Geräte kommen beispielsweise bei der Polizei zum Einsatz, wenn im Rahmen einer Verkehrskontrolle die Fahrtüchtigkeit von Auto-, Motorrad- oder FahrradfahrerInnen geprüft werden soll.
Entscheidungshilfe nach einer langen Nacht
Alkoholtester eignen sich, um Ihnen nach einem Getränk in der Kneipe oder auch nach einer durchfeierten Nacht bei einer Party, einer Firmenfeier oder dem Stammtisch einen Näherungswert Ihres Promillewertes anzuzeigen. Hierauf aufbauend können Sie die Entscheidung fällen, ob Sie noch mit dem Auto nach Hause fahren dürfen. Am besten befolgen Sie natürlich die einfache Maxime: Don’t drink and drive.

Wie funktioniert eine Atemalkoholmessung?
Für eine Alkoholkontrolle pustet der oder die zu Testende ein paar Sekunden in ein Röhrchen. Anschließend kann der oder die Prüfende das Ergebnis innerhalb kürzester Zeit ablesen: entweder durch eine Verfärbung bei einem analogen Einmal-Blasröhrchen oder durch die Anzeige eines Promillewertes auf einem digitalen Display. Letztere elektronische Varianten sind mehrfach benutzbar. Das heißt, Sie müssen zwischen den Anwendungen lediglich das Mundstück wechseln, um eine sterile Verwendung sicherzustellen.
Wieso ist der Alkoholwert messbar?
Bei normaler Atmungsaktivität ohne den Konsum alkoholischer Getränke nehmen die Lungenbläschen Sauerstoff auf und geben Kohlendioxid ab. Nach dem Konsum von Alkohol wird auch Ethanol über die Atemluft ausgestoßen, der aus dem Blutkreislauf stammt. Diesen Ethanol-, also Alkoholgehalt der Atemluft kann man durch die Messinstrumente ermitteln. Dadurch können die Beamten dann Rückschlüsse auf den Promillewert ziehen. Der Blutalkoholspiegel in Promille ist zahlenmäßig doppelt so groß wie der Atemalkoholgehalt in Milligramm pro Liter. Für den Fall, dass Sie mit einem Alkoholtester, der einen Wert in „mg/l“ ausgibt, messen, müssen Sie den Wert verdoppeln, um auf den Promillegehalt der Atemluft zu kommen.
Alkohol-Promillegrenze im Straßenverkehr
Die gefährlichen Auswirkungen von Alkohol werden häufig unterschätzt. Laut Zahlen der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht sind ein Viertel der jährlich 30.000 Verkehrstoten in der Europäischen Union auf Alkohol zurückzuführen. Alkohol ist ein weit verbreitetes, legales Rauschmittel, das in allen gesellschaftlichen Schichten sehr verbreitet ist. Bei vielen Traditionsfesten gehört das Glas Bier oder Wein dazu.

Der Konsum von Alkohol verlängert die Reaktionszeit, was in brenzligen Situationen verheerende Folgen haben kann. Die Gefahren werden häufig unterschätzt Egal ob Auto-, Motorrad-, Fahrradfahrende oder FußgängerInnen. Bereits nach geringem Alkoholeinfluss steigt das Unfallrisiko. Hör- und Sehvermögen werden beeinträchtigt, die Konzentrations- und Reaktionsfähigkeit nimmt spürbar ab. Das führt dazu, dass Distanzen sowie Geschwindigkeiten falsch eingeschätzt werden. Dadurch werden Betrunkene weniger gefahrenbewusst und risikofreudiger. Auf die genauen Promillegrenzen in Deutschland gehen wir in einem Extra-Kapitel im weiteren Verlauf des Textes ausführlich ein.
Verschiedene Ausführungen
Es gibt zwei verschiedene Varianten: einfache Einmal-Blasstäbchen, die den Atemalkoholwert durch eine chemische Reaktion grob eingrenzen, und elektronische Varianten, die den Wert auf einem Display anzeigen.
Blasröhrchen: die günstige Einmal-Variante
Diese Form des Alkoholtests gibt es schon lange. Die Firma Dräger startete ihre Produktion im Jahre 1953. Handelt es sich um eine Version mit Beutel müssen Sie solange pusten, bis der Beutel vollständig mit Atemluft gefüllt ist. Bei Versionen ohne Beutel ist der Gebrauch umständlicher, da Sie nicht in allen Fällen eine exakte Angabe dazu finden, wie lange und mit welchem Druck Sie pusten müssen. Die Kontrolle durch den aufgeblasenen Beutel fehlt.

Diese als Blasröhrchen oder Alcotests bekannt gewordenen, simplen Modelle reagieren chemisch auf das nach dem Trinken in der Atemluft enthaltene Ethanol. Verfärben sich die Chemikalien in dem Röhren, kann auf einen Alkoholkonsum geschlossen werden. Je stärker die Verfärbung ausfällt, desto höher war der Alkoholkonsum. Vorteil dieser Methode ist der geringe Anschaffungspreis. Nachteilig ist die einmalige Verwendungsmöglichkeit und die notwendige Interpretation durch der Verfärbung. Eine klare Ablesbarkeit, wie bei den Modellen mit Display gegeben, fehlt. Sofern die Modelle mit einem entsprechenden Hinweis versehen sind, eignen sie sich für das vorgeschriebene Mitführen in Frankreich.
Mitführpflicht in Frankreich
In Frankreich gilt eine Mitführpflicht für Alkoholtester. Ob es sich dabei um ein Einweg-Blasröhrchen oder ein digitales Messgerät handelt, ist unerheblich. Wichtig ist dagegen, dass der Tester eine Zulassung nach französischer Norm erhalten hat. In verschiedenen Online-Shops wird die Konformität mit dem NF-Zertifikat gekennzeichnet. Da es in Frankreich aber mitunter schwierig ist, entsprechende Geräte im Handel zu bekommen – sie sind schlichtweg ausverkauft –, gilt derzeit folgende skurrile Rechtslage: Es ist verpflichtend, einen Alkoholtester im Auto mitzuführen, es drohen aber bei Nichtbeachtung keine Strafen.
Elektronische Alkohol-Tester: mehrfach verwendbar
Elektronische Alkoholtester, auch Handmessgeräte oder Alkoholtestgerät genannt, kennen Sie vielleicht bereits von einer Verkehrskontrolle der Polizei. Zwar sind die im Privatbereich eingesetzten Modelle sind oftmals weniger genau als die teureren Profi-Geräte der Polizei. Diese gibt es teils auch für den PrivatanwenderInnen zu kaufen, in den meisten Fällen stimmt aber das Preis-Leistungsverhältnis für diese Anwendergruppe nicht. Die Messfehler handelsüblicher Geräte für PrivatanwenderInnen liegen im Bereich von ungefähr 5 Prozent. Damit geben sie allerdings noch immer eine ausreichende Orientierungs- und Entscheidungshilfe für Straßenverkehrsteilnehmer. Gute Geräte werben damit, dass sie Messgenauigkeiten von 0,05 Promille erreichen.

Drei verschiedene Mess-Methoden
Die Messung erfolgt im Gegensatz zu einem Blasrohr nicht durch eine chemische Reaktion und einen darauffolgenden Farbumschlag. Bei den elektronischen Alkoholtestern unterscheidet man drei verschiedene Techniken: Geräte mit elektrochemischem Sensor, mit Halbleiter-Sensor und mit Infrarotsensor.
Die Modelle mit elektrochemischem Sensor sind am weitesten verbreitet. Bei diesen Modellen überwachen Elektroden, ob ein zu analysierender Stoff, in diesem Fall Ethanol, vorhanden ist. Ist dies der Fall, kommt es zwischen den Elektroden zu einer elektrochemischen Reaktion. Die entstehende Spannungsdifferenz verursacht ein Sensorsignal, das zur Bestimmung der Stoffkonzentration verwendet wird.
Bei Modellen mit einem Halbleitersensor findet im Falle eines Ethanol-Vorkommens eine Oxidation unter Verbrauch von Sauerstoff statt. Auf diese Weise wird der Alkoholgehalt in der Atemluft gemessen.
Bei Modellen mit Infrarotsensor funktioniert die Messung der Alkoholkonzentration durch die Absorption von bestimmten Wellenlängen des Lichts.
Benutzung und Vorzüge der elektronischen Modelle
Für die Analyse pustet der Kontrollierte in ein Mundstück, das auf die Einblasöffnung des Gerätes gesteckt wird. In der Regel kommt das Mundstück nur einmalig zum Einsatz. Um die Hygienebestimmungen einzuhalten, empfiehlt es sich, dieses im Anschluss wegzuwerfen. Diese Geräte sind viele Male benutzbar. In regelmäßigen Abständen ist allerdings eine Kalibrierung seitens des Herstellers nötig.
Die Vorteile der elektronischen Geräte sind also die höhere Messgenauigkeit im Vergleich zum Blasröhrchen, die mehrfache Verwendbarkeit der Geräte, und die Möglichkeit, die gemessenen Werte auf dem Display ablesen zu können, um im Vergleich zum Blasröhrchen keinen Interpretationsspielraum zu haben.
Nachteilig sind ein im Vergleich zu den Einmalblasröhrchen höherer Anschaffungspreis, die Notwendigkeit einer Energiequelle, meist einer Batterie, und die Notwendigkeit einer regelmäßigen Kalibrierung durch den Hersteller.
Die auf den Digitalanzeigen gezeigten Werte sind nicht als Beweismittel vor Gericht zugelassen. Rechtssicherheit bringt bei einem Verdacht auf Alkoholkonsum durch Ausfallerscheinungen oder einem auffälligen Atemalkohol-Test nur ein richterlich angeordneter Bluttest.
Stationäre Messanlagen und Alcolock
Neben diesen drei mobilen Messgeräten gibt es auch stationäre Messgeräte, die allerdings weniger verbreitet sind. Sie haben eine höhere Genauigkeit als die Handgeräte, da in vielen Fällen sowohl eine elektrochemische als auch eine Infrarot-Messung durchgeführt wird. Diese höhere Messgenauigkeit spiegelt sich aber auch in einem höheren Anschaffungspreis wider. In unserem Vergleich finden sich allerdings nur mobile Alkohol-Testgeräte.
Ein Alcolock, auch als Alkohol-Zündschlosssperre, Alkohol-Interlock oder Alkohol-Wegfahrsperre bezeichnet, ist ein fest in einem Auto installiertes Alkoholmessgerät. Vor dem Zünden muss der Fahrer oder die Fahrerin einen Alkoholtest durch „Pusten“ absolvieren. Der Motor startet nur dann, wenn die zuvor eingestellte Promillegrenze nicht überschritten wird. Das System soll auf diese Weise Alkoholfahrten verhindern.
Gesetzliche Pflicht zum Alkoholtest vor der Fahrt
In den USA kann alkoholauffälligen Fahrzeughaltern der Einbau eines solchen Systems auferlegt werden. Beispielsweise ist in Frankreich seit einigen Jahren der Einsatz in Schulbussen vorgeschrieben. In Deutschland und Österreich gibt es bislang keine gesetzlichen Rahmenbedingungen für den staatlich verordneten Einsatz. Wer System nachträglich einbauen möchte, muss mit Kosten ab 1.000 Euro rechnen.
Promillegrenzen in Deutschland
In Deutschland gelten strenge Regeln bezüglich der Teilnahme am Straßenverkehr unter Alkoholeinfluss. Wir erklären im Folgenden, wann Sie Auto, Motorrad oder Fahrrad stehen lassen, die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen, ein Taxi nehmen oder laufen sollten.
Promillegrenzen für Auto- und MotorradfahrerInnen
Die Teilnahme am Straßenverkehr ist unter dem Einfluss von Alkohol nicht erlaubt. Das gilt nicht nur für einen Vollrausch. Wer bei einem bestimmten Promillewert erwischt wird, gerät ebenfalls in eine missliche Lage – seien es Auto-, Motorrad- oder FahrradfahrerInnen. Viele vergessen, dass nicht nur der akute Rausch, sondern auch der Restalkohol am Morgen Folgen haben kann.

FahrerInnen, die einen Promillewert von 0,5 bis 1,09 aufweisen oder als FahranfängerInnen gegen das absolute Alkoholverbot verstoßen und keine alkoholbedingten Auffälligkeiten wie Schlangenlinien oder riskante Wahlmanöver zeigen, begehen eine Ordnungswidrigkeit. Sie erhalten einen Bußgeldbescheid, der in der Regel mit einer Strafzahlung von 500 Euro, einem Monat Fahrverbot und zwei Punkten in Flensburg gekoppelt ist. Nach Ablauf des Fahrverbotes erhält der Verkehrssünder oder die Verkehrssünderin den Führerschein zurück.
Für FahranfängerInnen gelten diese Grenzen nicht
Für FahranfängerInnen, die sich innerhalb der zweijährigen Probezeit befinden oder unter 21 Jahre alt sind, gilt ein komplettes Alkoholverbot. Wer unter der Wirkung von Alkohol am Steuer erwischt wird, zahlt 250 Euro Bußgeld und erhält einen Punkt in Flensburg. Es folgt ein Aufbauseminar sowie die Verlängerung der Probezeit von zwei auf vier Jahre.
Absolute Fahruntüchtigkeit
Bei höheren Promillewerten handelt es sich nicht mehr um eine Ordnungswidrigkeit, sondern bereits um eine Straftat Diese tritt dann ein, wenn FahrerInnen mit einer Blutalkoholkonzentration von 1,1 Promille oder mehr am Steuer sitzen. Ob es dabei zu Ausfallerscheinungen gekommen ist oder nicht, spielt keine Rolle.
Relative Fahruntüchtigkeit
Auch bei geringen Promillewerten, etwa ab 0,3 Promille, kann bereits eine Straftat statt einer Ordnungswidrigkeit bestehen, sofern alkoholbedingte Ausfallerscheinungen vorliegen. Damit sind beispielsweise eine Schlangenlinienfahrt oder ein alkoholtypischer Unfall gemeint. In diesem Fall droht eine Geldstrafe, bei wiederholtem Feststellen sogar eine Freiheitsstrafe. Die Fahrerlaubnis wird für mindestens ein halbes Jahr eingezogen. Bei einem alkoholbedingten Unfall erhöht sich die Sperre auf ein ganzes Jahr.
Strafrechtliche Konsequenzen
Die Höhe der bei Straftaten verhängten Geldstrafe richtet sich immer nach den wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters oder der Täterin. Zusätzlich wird in der Regel die Fahrerlaubnis entzogen und eine Sperrfrist festgesetzt. Vor deren Ablaufen kann keine neue Fahrberechtigung erteilt, also keine neue Führererschein-Prüfung unternommen werden. Ab der Schwelle von 1,6 Promille ist zudem vor der Neuerteilung die medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) vorgeschrieben. Das gilt auch bei wiederholten Trunkenheitsfahrten.
Versicherungsrechtliche Konsequenzen
Bei einem Unfall, der unter Alkoholeinfluss verursacht wurde, hat die Versicherung die Möglichkeit, den Fahrer oder die Fahrerin für Fremdschäden bis 5.000 Euro zur Kasse zu bitten. Bei einer Vollkaskoversicherung kann der Versicherer die Zahlungsübernahme für den auszugleichenden Eigenschaden verringern oder verweigern.
Vorsicht auch beim Griff zum Fahrrad
Nicht nur Auto- und MotorradfahrerInnen müssen nach dem Kneipenbesuch aufpassen. Auch für RadfahrerInnen gibt es eine Promillegrenze. Ab 1,6 Promille ist das Radeln eine Straftat und wird neben einer Geldstrafe in Höhe eines Monatsnettogehaltes mit zwei Punkten in Flensburg bestraft. Zudem wird die medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) angeordnet. Wer diese nicht besteht, muss seinen Führerschein abgeben. In seltenen Fällen kann die Behörde sogar das Fahrradfahren verbieten, wenn die Gefahr einer wiederholten Trunkenheitsfahrt gesehen wird.
Keine Promillegrenze für Fußgänger, aber…
Eine festgeschriebene Promillegrenze für FußgängerInnen gibt es nicht. Wenn Sie als betrunkener Fußgänger oder betrunkene Fußgängerin allerdings einen Unfall verursachen, müssen Sie dennoch mit rechtlichen Konsequenzen rechnen und für den Schaden haften.
Vorsicht vor Messungenauigkeiten
Viele Alkoholtester zeigen lediglich einen Näherungswert an. Einige hochwertige Digital-Modelle arbeiten mit geringen Abweichungen. Die Messgeräte, die bei Polizeikontrollen eingesetzt werden, haben beispielsweise eine maximale Abweichung von etwa 0,05 Promille des Alkoholwertes. Trotzdem sollten Sie sich immer Ihrer eigenen Verantwortung bewusst sein: Zwar kann ein solches Gerät einen groben Orientierungswert liefern, aber niemals eine Entscheidung abnehmen. Im Zweifelsfall sollten Sie beispielsweise auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen.
Eine strafrechtliche Relevanz hat im Fall einer Polizeikontrolle ohnehin nicht das Ergebnis des Atemalkohol-, sondern eines im Zweifelsfall richterlich angeordneten Bluttests. Dieser wird durch einen Arzt oder einer Ärztin durchgeführt und liefert in der Regel einen etwas höheren Wert als der Atemtest.
Vor dem „Pusten“ nichts konsumieren und Test wiederholen
Um ein aussagekräftiges Ergebnis zu erhalten, darf der Fahrer oder die Fahrerin zehn Minuten vor dem „Pusten“ keine Substanzen mehr zu sich nehmen. Er sollte also weder essen und trinken noch rauchen oder Medikamente einnehmen. Zwischen dem letzten alkoholischen Getränk und der Messung sollten 20 Minuten vergangen sein. So können Sie sicherstellen, dass der Alkohol bereits im Blut angekommen ist. Um die Gefahr von Messfehlern beziehungsweise eines steigenden Wertes zu verringern, sollten Sie den Test nach fünf Minuten wiederholen. Im Idealfall unterscheidet sich das zweite Ergebnis nicht merklich vom ersten.
Darf der Arbeitgeber Alkoholtests durchführen?
In der Regel sind alle ArbeitnehmerInnen verpflichtet, am Arbeitsplatz und während der Arbeitszeiten auch außerhalb des Arbeitsplatzes auf alkoholische Getränke zu verzichten. Prinzipiell ist der Arbeitgeber berechtigt, die Einhaltung zu kontrollieren. Das gilt aber nur dann, wenn ein begründeter Verdacht besteht, dass der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin sich unter dem Einfluss von Restalkohol am Arbeitsplatz befindet. Die Massenkontrolle einer Abteilung oder Stichproben ohne begründeten Verdacht ist nicht statthaft. Ausnahmen gelten, sofern der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin sogenannte gefahrgeneigte Tätigkeiten ausübt. Beispiele sind PilotInnen, PolizistInnen, Feuerwehrleute, BusfahrerInnen und ähnliche Berufsfelder, in denen Angestellte am Straßenverkehr teilnehmen oder Maschinen bedienen.
Wer hat Promilletester getestet?
Achtung: Hierbei handelt es sich lediglich um einen Alkoholtester-Vergleich. Wir haben die vorgestellten Produkte keinem Test unterzogen.
Bei der in Deutschland hoch angesehenen Stiftung Warentest haben wir keinen Test zu Alkoholtestern finden können.
Der ADAC bemängelte, dass die Blasröhren kurz nach der Mitführpflicht in ganz Frankreich ausverkauft und auch in Deutschland kaum verfügbar waren. Die TesterInnen des Automobilclubs prangerten außerdem Messungenauigkeiten der französischen Modelle an.
Ein Test der Technischen Universität Wien aus dem Jahr 2015 beschäftigt sich mit der Richtigkeit von Alkoholtester-Messungen. Das Testfeld wirkt ein wenig unausgewogen: Von den elf getesteten Produkten sind zehn Modelle von ACE Instruments. Lediglich das Modell Alcotest 3000 stammt aus der Produktion der Firma Dräger.
Beim Test selbst zeigen sich Unterschiede hinsichtlich der Messgenauigkeit. Die Modelle ACE II Basic (99,0 Prozent Messgenauigkeit), Dräger Alcotest 3000 (98,9 Prozent), ACE one (98,6 Prozent), ACE Public V (98,0 Prozent) und ACE AF-33 (97,9 Prozent) stehen allesamt bezüglich der Richtigkeit der Werte gut da.
Viel zu ungenau sind hingegen drei Modelle, namentlich ACE Pro Med Basic (88,5 Prozent), ACE II Premium (86,2 Prozent) sowie ACE Stat. Alkoholtester (77,1 Prozent). Vor allem letzteres Modell ist für das Selbstmessen des Promillespiegels ungeeignet.
Teaserbild: © Zstock / stock.adobe.com | Abb. 1: © wstockstudio / stock.adobe.com | Abb. 2:© Vladimir Mucibabic / stock.adobe.com | Abb. 3: © Sébastien / stock.adobe.com | Abb. 4: © Andrey Popov / stock.adobe.com | Abb. 5: © burdun / stock.adobe.com