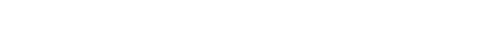Rauchmelder-Kaufberatung:
So finden Sie das passende Produkt
- Das Wichtigste in Kürze
- Rauchmelder warnen frühzeitig vor Bränden und können Leben retten.
- Beim Kauf sollten Verbraucher immer auf die EU-Norm-Zertifizierung achten.
- Bei der Installation von Rauchmeldern müssen die baurechtlichen Vorgaben der Bundesländer beachtet werden.
- Die Rauchmelderpflicht in Neubauten gilt mittlerweile in allen deutschen Bundesländern.
- Wichtig: Rauchmelder in Privathaushalten geben bei Alarm keine Meldung an die Feuerwehr weiter.
- Die meisten Rauchmelder sind für Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer und Arbeitszimmer geeignet. Aufgrund der Dampfentwicklung werden für Küche und Bad hingegen Hitzemelder als Brandschutzalarm empfohlen.
Sicherer Wächter bei Gefahr durch Rauch
Bereits eine umgefallene Kerze kann innerhalb kurzer Zeit zu einem gefährlichen Wohnungsbrand führen. Ein Rauchmelder registriert frühzeitig die Rauchentwicklung eines entstehenden Brandes und warnt rechtzeitig vor der Gefahr. Diese kleinen Geräte schützen somit vor schweren Verletzungen und können sogar Leben retten.
Was ist ein Rauchmelder?
Ein Rauchmelder ist ein unauffälliges Kästchen mit einer lebensrettenden Funktion. Pro Jahr sterben rund 500 Menschen in Deutschland durch Wohnungsbrände. Verbrennungen sind jedoch nur selten die Ursache, denn bei etwa 95 Prozent der Fälle führen giftige Rauchgase zum Tod der betroffenen Personen. Häufig werden Menschen im Schlaf von einem Feuer überrascht und haben ohne installierte Rauchmelder nahezu keine Chance, den Rauch frühzeitig zu bemerken. Während das menschliche Gehör auch in der Tiefschlafphase zuverlässig funktioniert, ist der Geruchssinn vollständig inaktiv. Rauch wird somit nicht wahrgenommen. Rauchmelder erkennen Rauchentwicklungen bereits frühzeitig und warnen umgehend mit lauten Alarmtönen. So gewinnen die Bewohner wertvolle Sekunden und können sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.
Rauchmelderpflicht in Deutschland
Auch der Gesetzgeber hat die lebensrettende Funktion von Rauchmeldern erkannt. Aus diesem Grund gibt es seit einigen Jahren in Deutschland die Rauchmelderpflicht, die jedoch nicht von allen Bundesländern zum gleichen Zeitpunkt umgesetzt wurde. Während für Neubauten in ganz Deutschland der Einbau von Rauchmeldern inzwischen verpflichtend ist, gilt die Nachrüstpflicht für Altbauten noch nicht in allen Bundesländern:
| Bundesland | Pflicht NEUBAU ab | Pflicht ALTBAU ab |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 11. Juli 2013 | 1. Januar 2015 |
| Bayern | 1. Januar 2013 | 31. Dezember 2017 |
| Berlin | 1. Januar 2017 | 31. Dezember 2020 |
| Brandenburg | 1. Juli 2016 | 31. Dezember 2020 |
| Bremen | 22. Dezember 2009 | 31. Dezember 2015 |
| Hamburg | 7. Dezember 2005 | 1. Januar 2011 |
| Hessen | 24. Juni 2005 | 31. Dezember 2014 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 18. April 2005 | 31. Dezember 2009 |
| Niedersachsen | 1. November 2012 | 1. Januar 2016 |
| Nordrhein-Westfalen | 1. April 2013 | 1. Januar 2017 |
| Rheinland-Pfalz | 22. Dezember 2003 | 12. Juli 2012 |
| Saarland | 18. Februar 2004 | 31. Dezember 2016 |
| Sachsen | 1. Januar 2016 | Keine Fristen |
| Sachsen-Anhalt | 21. Dezember 2009 | 31. Dezember 2015 |
| Schleswig-Holstein | 1. Januar 2015 | 31. Dezember 2010 |
| Thüringen | 5. Januar 2008 | 31. Dezember 2018 |
In allen Bundesländern ist jeweils der Eigentümer einer Wohnung zur Installation der Rauchmelder verpflichtet. Somit fällt die Installation in Mietwohnungen in den Verantwortungsbereich des Vermieters. Von behördlicher Seite finden keine Kontrollen statt, dennoch kann es bei einem Verzicht auf die Montage von Rauchmeldern zu großen Problemen kommen. Lediglich bei Neubauten wird im Rahmen der Bauabnahme kontrolliert, ob die Installation von Rauchmeldern erfolgt ist.
Wenn keine Rauchmelder installiert wurden, kann beispielsweise die Versicherung nach einem Brand die Leistungen einschränken. Dies wäre theoretisch zwar nur dann möglich, wenn der Versicherer nachweisen könnte, dass Rauchmelder den Brand verhindert oder zumindest den entstandenen Schaden verringert hätten – dennoch sind in solchen Fällen Verzögerungen bei der Auszahlung der Leistungen häufig vorprogrammiert. Das Amtsgericht Hamburg-Blankenese verkündete im Jahr 2013 in einem Urteil, dass Eigentümer ihren Versicherungsschutz in der Gebäudeversicherung gefährden, wenn sie gegen die Rauchmelderpflicht verstoßen (Az. 531 C 125/13). Das wichtigste Argument für den Einbau von Rauchmeldern ist jedoch der Schutz des eigenen Lebens, daher sollten sie idealerweise in jeder Wohnung installiert sein.
Wie funktioniert ein Rauchmelder?
Als Brandfrühwarnsystem warnt der Rauchmelder schon bei geringer Rauchentwicklung mit einem lauten Signalton. Wie erkennt die kleine Box an der Decke, dass es irgendwo im Zimmer raucht? Die Hersteller von Rauchmeldern machen sich hierfür unterschiedliche physikalische Effekte zu Nutze, bei der die Zusammensetzung der Raumluft gemessen wird. Was die Funktionsweise betrifft, so kann man im Groben drei Typen von Rauchmelde-Erkennungssystemen unterscheiden:
- Foto-Optische Rauchmelder
- Laserrauchmelder
- Thermo-Optische Rauchmelder
- Ionisationsrauchmelder
Die Klassiker: Foto-Optische Rauchmelder
Bei der überwiegenden Anzahl der in Deutschland angebotenen Geräte handelt es sich um optische Rauchmelder. Eine andere Bezeichnung, die man in den Produktbeschreibungen dieses Rauchmelder-Typs findet, ist fotoelektronischer Rauchwarnmelder.
Diese Geräte stellten mithilfe von Lichtstrahlen fest, ob sich Rauch in der Luft befindet. Das Warnsystem nutzt dabei den Tyndall-Effekt und arbeitet nach dem Streulichtprinzip.
Im Allgemeinen ist ein optischer Rauchmelder wie folgt aufgebaut:
In dem Warngerät befindet sich eine Rauchkammer, in der eine LED-Leuchtdiode und eine Fotolinse vorhanden sind. Ein Kaskadeneingang sorgt dafür, dass kein kleines Insekt in diese Rauchmesskammer eindringen und einen Fehlalarm auslösen kann. Bei manchen Modellen schützt ein Fliegengitter die Öffnungen. Im Inneren der Kammer sendet die LED-Diode in regelmäßigen Abständen Lichtstrahlen aus. Diese werden bei klarer Luft nicht reflektiert und treffen daher nicht auf die Fotolinse auf. Kommt es zu einer Rauchentwicklung, gelangen kleine Rauchpartikel in die Messkammer. Der Rauch reflektiert die Lichtstrahlen anders als die klare, reine Luft. Einige Lichtstrahlen werden durch die Rauchpartikel abgelenkt und treffen auf die Fotolinse. Dies führt unmittelbar dazu, dass der Alarm ausgelöst wird.
Ein Fehlalarm durch Lichteinflüsse von außen ist ausgeschlossen und wird effektiv durch ein Labyrinth aus schwarzem Material verhindert. Bestimmte Software-Algorithmen kompensieren die Verschmutzungen, die durch den herkömmlichen Betrieb entstehen. Auch dies sorgt dafür, dass Fehlalarme vermieden werden. Die Energieversorgung erfolgt bei diesem Rauchmelder-Typ per Batterie. Die regelmäßige Wartung und Alarmüberprüfung ist bei diesem Rauchwarnsystem damit verpflichtend und erhöht die Sicherheit. Mit dem foto-optischen Verfahren arbeiten beispielsweise die Ei Electronics Rauchmelder ebenso wie das Modell 6800 von Busch-Jäger.
Laser-Rauchmelder
Laserrauchmelder besitzen das gleiche Funktionsprinzip wie die optischen Rauchmelder, sind jedoch mit einer hellen Laserdiode ausgestattet. Damit reagieren sie deutlich sensibler als die herkömmlichen Rauchwarngeräte mit Leuchtdiode. Kleinste Rauchpartikel in der Luft erkennt ein Laser-Rauchmelder zuverlässig.
Thermo-Optische Rauchmelder
Ein thermo-optischer Rauchmelder vereint zwei Brandmeldesysteme: die Rauchwarnung und die Hitzewarnung. Der Rauchmelder funktioniert nach demselben Prinzip wie es oben bei den optischen Rauchmeldern beschrieben ist. Ergänzt wird die Ausstattung um ein Heißleitersystem, das auf die Umgebungstemperatur reagiert. Ein Heißleiter erfasst die Umgebungstemperatur, ein weiterer Heißleiter dient als Vergleichswert. Wenn die Messung einen schnellen Temperaturanstieg ergibt und einen kritischen Punkt überschreitet, wird der Alarm ausgelöst. Reine Hitzemelder sind nicht für den Einsatz in Privathaushalten gedacht. Sie würden die Bewohner zu spät alarmieren. Vor allem, falls ein Brand in der Nacht entsteht, wäre die Luft zu dem Zeitpunkt, wenn der Hitzemelder den Brand feststellt, bereits mit so viel Rauch erfüllt, dass es für den Menschen gesundheitsschädigend, wenn nicht sogar lebensbedrohlich wäre. Mit dem Thermo-Optischen Rauchmeldern verhält es sich jedoch anders. Eine Kombination aus optischem und thermischem Rauch- beziehungsweise Branderkennungsverfahren macht den Rauchmelder jedoch zu einem Universal-Gerät, das für viele Räume geeignet ist. Ihre Stärke ist es, dass sie vor Schwelbränden und vor schnellen Brandverläufen warnen. Ein Beispiel für diesen Typ Rauchmelder ist das Modell FireAngel ST-630-DET, das auch von der Stiftung Warentest mit einem Siegel ausgezeichnet wurde.
Ionisationsrauchmelder
Ionisationsrauchmelder arbeiten mit einem schwach radioaktiven Präparat. In der Messkammer des Melders wird die Luft ionisiert, so dass ein schwacher Messstrom. Wenn Rauchpartikel in die Kammern gelangen, verändert sich der Ladungsstrom durch die Anlagerung von Ionen. Die Mittelelektrode fungiert als Spannungsteiler. Der Messverstärker des Rauchmelders wertet die entstehende Spannungsänderung aus und es wird Alarm ausgelöst. Ein Ionisationsrauchmelder besitzt ausgezeichnete Detektionseigenschaften. Aufgrund der europäischen Strahlenschutzverordnungen wird er in Deutschland jedoch nur in Sonderfällen eingesetzt und findet sich nicht in Privathaushalten. In Nordamerika sind diese Rauchmelder-Typen jedoch noch immer weit verbreitet.
Verschiedene Arten von Rauchmeldern
Das Angebot im Handel ist vielfältig und reicht von günstigen Klassikern über Funk-Rauchmelder bis zu innovativen Smart-Home-Rauchmeldern. Jede Variante hat entscheidende Vor- und Nachteile, die bei der Auswahl der passenden Warnmelder eine große Rolle spielen.
Einfache Rauchmelder
Einfache Modelle gibt es bereits für wenig Geld bei Baumärkten und Discountern. Von Zeit zu Zeit müssen hier die Batterien ausgetauscht werden, dies wird jedoch von dem jeweiligen Rauchmelder frühzeitig per Alarm angezeigt. Diese Modelle sind gut geeignet für:
- kleine Wohnungen
- alle Wohnräume, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Flur
- Räume ohne hohe Luftfeuchtigkeit
Bei größeren Anwesen kann es aufgrund der fehlenden Vernetzung der einzelnen Geräte dazu kommen, dass ein Alarm in einem entfernter liegenden Raum leichter überhört wird.
| Pro | Kontra |
| Günstiger Kaufpreis | Meist keine Komfortfunktionen (Stummschaltung, etc.) |
| Einfache Montage | Regelmäßiger Battertietausch notwendig |
| Häufig auch als Sets erhältlich | Für größere Wohnungen weniger gut geeignet |
| Gute Zuverlässigkeit |
Funk-Rauchmelder
Bei größeren Häusern sind vernetzbare Funk-Rauchmelder empfehlenswert, da bei Rauchentwicklung in einem Zimmer ein Signal an alle vernetzten Geräte gesandt und somit in der ganzen Wohnung Alarm ausgelöst wird. Diese Varianten eignen sich für folgende Einsatzbereiche:
- größere Häuser
- größere Wohnungen mit mehreren Etagen
- alle Wohnräume, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Flur
Eine besonders clevere Variante sind die intelligenten Smart-Home-Rauchmelder. Sie können in bestehende oder neue Smart-Home-Systeme integriert werden und ermöglichen interessante Zusatzfunktionen. So kann beispielsweise neben dem Alarmton auch eine automatische Benachrichtigung an das Smartphone des Bewohners ausgelöst werden.
| Pro | Kontra |
| Hohe Reichweite durch Vernetzbarkeit der Rauchmelder | Deutlich höhere Anschaffungskosten |
| Einfache Installation | Regelmäßiger Batteriewechsel erforderlich |
| Sehr zuverlässig |
Kabelvernetzbare Rauchmelder
Neben der Vernetzbarkeit per Funk gibt es im Fachhandel auch Rauchmelder, die per Kabel mit anderen Meldern in der Wohnung verbunden werden. Diese 230-Volt-Rauchmelder sind mit Batterien ausgestattet und gleichzeitig wird das System per Kabel an das Stromnetz angeschlossen. So werden die Batterien entlastet und gleichzeitig ist auch bei Stromausfall ein zuverlässiger Schutz gewährleistet. Aufgrund des großen Installationsaufwandes wird dieses System meist nur im gewerblichen Bereich eingesetzt, bei Neu- oder Umbauten von Privathäusern kann es jedoch ebenso installiert werden. Kabelvernetzbare Rauchmelder können in folgenden Bereichen eingesetzt werden:
- Gewerbeobjekte
- private Neubauten
- bei Renovierung / Umbau von privaten Gebäuden
- Mietobjekte
Bei diesem System besteht zusätzlich die Möglichkeit zur Kopplung an eine Alarmanlage.
| Pro | Kontra |
| Hohe Reichweite durch Vernetzbarkeit | Sehr hohe Anschaffungskosten |
| Kombination aus Stromversorgung & Batterien | Hoher Installationsaufwand |
| Sehr zuverlässig |
Rauchmelder mit Lithiumbatterie
Rauchmelder mit Lithiumbatterien bieten eine höhere Betriebszeit von 5 bis 10 Jahren und sind in der Regel etwas teurer als herkömmliche Modelle. Bei diesen Meldern sind die Batterien fest verbaut und können nicht ausgetauscht werden. Somit ist bei aufgebrauchter Batterie ein Austausch des gesamten Gerätes notwendig. Die Verwendungsempfehlungen sind identisch mit den Angaben zu herkömmlichen Rauchmeldern:
- kleine Wohnungen
- alle Wohnräume, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Flur
- Räume ohne hohe Luftfeuchtigkeit
Wie alle Modellvarianten haben auch die Rauchmelder mit fest eingebauten Lithiumbatterien Vor- und Nachteile, die bei der Auswahl der Rauchmelder Beachtung finden sollten.
| Pro | Kontra |
| Lange Betriebsdauer | Teurer als klassische Rauchmelder |
| Einfache Installation | Kein Batteriewechsel möglich |
| Sehr zuverlässig |
Rauchmelder, Hitzemelder, Gasmelder – welche Unterschiede gibt es?
Immer wieder greifen Verbraucher auf der Suche nach Rauchmeldern zu Geräten, die als Hitzemelder, Gasmelder oder CO-Melder deklariert sind. Da es hier jedoch gravierende Unterschiede gibt, kann eine Übersicht zu den verschiedenen Gerätearten zu einer besseren Unterscheidung beitragen.
Brandmelder und Brandmeldeanlage
Die Bezeichnung „Brandmelder“ wird allgemein als Oberbegriff für alle Arten von Anlagen und Geräten genutzt, die mit Alarmsignalen vor Bränden warnen. Brandmeldeanlagen (BMA) werden insbesondere dort eingesetzt, wo aufgrund baulicher Besonderheiten eine frühzeitige Evakuierung besonders wichtig ist. Dies ist beispielsweise in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, Bahnhöfen, Schulen und Universitäten, Bahnhöfen, Flughäfen sowie großen Firmengebäuden und Fabrikhallen der Fall.
Es können unterschiedliche Einrichtungen angesteuert werden, die im Fall eines Brandes aktiviert werden:
- Alarmsignale im ganzen Gebäude
- Öffnung von Einrichtungen zur Rauchableitung
- Aktivierung einer Löschanlage
- Meldung an die Leitstelle der örtlichen Feuerwehr
Alarmsignale: In Deutschland müssen bauordnungsrechtlich erforderliche Brandmeldeanlagen den strengen Vorgaben nach DIN 14675 entsprechen.
Rauchwarnmelder
Die umgangssprachlich als Rauchmelder bezeichneten Geräte werden im Handel häufig unter der Bezeichnung Rauchwarnmelder angeboten.
Wichtiger Hinweis!
Herkömmliche Rauchwarnmelder für Privathaushalte dürfen nicht auf die Feuerwehr aufgeschaltet werden. Viele Funkrauchmelder ermöglichen zwar die Aufschaltung durch ein zusätzlich anschließbares Telefonwahlgerät, mit der beispielsweise ein Wachschutzunternehmen informiert wird.
Hitzemelder oder Wärmemelder
Als Wärmemelder oder Hitzemelder werden Geräte bezeichnet, die dank eingebauter Temperatursensoren auf die Erhöhung der Umgebungstemperatur reagieren. Im Gehäuse des Melders befindet sich ein Heißleiter, der die gemessene Raumtemperatur mit den vorbestimmten Referenzwerten vergleicht:
- Maximalwert = meist 60 Grad Celsius
- schneller Temperaturanstieg = meist um 5 Grad Celsius 5 innerhalb von 3 Minuten
Bei einem Brand löst das Gerät einen lauten Alarmton aus. Sie sind kein Ersatz für herkömmliche Rauchmelder, können jedoch in bestimmten Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder anderen Belastungen der Raumluft (beispielsweise Werkstatt, Küche oder Badezimmer) als zusätzlicher Schutz installiert werden.
Gasmelder
Die Installation von Gasmeldern ist immer dann empfehlenswert, wenn ein Gasofen, eine Gastherme oder Gasleitungen vorhanden sind. Erdgas ist leicht entzündlich, daher besteht bei einer größeren Gaskonzentration die Gefahr der Selbstentzündung. Ein Gasmelder stellt bei einem Defekt die austretenden Gase fest und schützt durch den frühzeitigen Alarm vor der Gefahr einer Explosion. Neben den Erdgasmeldern gibt es im Handel auch Melder für Propangas.
CO-Melder
Für Haushalte mit Gastherme, Kamin, Kohleofen, einem Kaminofen ist neben den Rauchmeldern zusätzlich auch die Anschaffung von Kohlenmonoxidmeldern (CO-Melder) unbedingt empfehlenswert. Kohlenmonoxid entsteht, wenn Brennstoffe (Holz, Pellets, Holzbriketts, Kohle, etc.) bei schlechter Sauerstoffzufuhr nur unzureichend verbrennen. Von dem Gas geht eine große Lebensgefahr aus. Es ist geruchlos, geschmacklos und farblos, daher kann es vom Menschen nicht wahrgenommen werden. Da es sich weit besser an Hämoglobin bindet als Sauerstoff, führt es je nach Konzentration zu gesundheitlichen Problemen und sogar zum Tod. Ein CO-Melder schlägt nach streng geregelten Vorgaben bei einer bestimmten Konzentration von Kohlenmonoxid an und kann so das Leben der anwesenden Personen retten.
Darauf sollten Sie beim Kauf eines Rauchmelders achten
Wenn der Kauf von Rauchmeldern ansteht, sind viele Menschen ratlos, welches Modell sie auswählen sollen. Die große Auswahl erschwert die Entscheidung und häufig besteht zudem auch große Unsicherheit im Hinblick auf die benötigte Anzahl. Auch bei günstigen Modellen sollte nicht der Preis alleine die Kaufentscheidung beeinflussen, da auch bei den einfachen Rauchmeldern unbedingt die Funktionalität gewährleistet sein muss. Für die Auswahl spielen daher unterschiedliche Kaufkriterien eine wichtige Rolle, die bei der Entscheidungsfindung sehr hilfreich sein können:
- CE-Zeichen
- EU-Norm-Zertifizierung nach DIN 14604
- evtl. weitere Prüfsiegel wie „VdS-Anerkennung“ oder Qualitätslabel „Q“
- mit oder ohne Vernetzbarkeit
- Größe des Rauchmelders
- Art der Energieversorgung
- Alarm-Typ (akustisch/optisch)
- technische Ausstattung
Normen, Zertifikate & Prüfsiegel
In Deutschland müssen alle im Handel angebotenen Rauchmelder seit 2008 mit dem CE-Kennzeichen ausgezeichnet werden. Diese Kennzeichnung zeigt an, dass der Warnmelder den strengen Anforderungen der Gerätenorm DIN EN 14604 entspricht. Diese DIN-Norm legt die Standards fest, die für Rauchmelder binden sind, die in er EU verkauft werden dürfen. Bei Prüfungen durch den TÜV oder die VdS Schadenverhütung GmbH ist diese Norm die maßgebliche Bedingung. Die Siegel dieser Prüfstellen gelten in Deutschland als anerkannte Qualitätsmerkmale.
Das „Qualitätszeichen Q“ kennzeichnet ausschließlich Rauchmelder, die besonders hohen Standards entsprechen. Dies wird von unabhängigen Testinstituten (VdS, etc.) geprüft. Neben der Einhaltung der Normvorschriften weisen diese Rauchmelder eine besonders hohe Stabilität auf und halten bestimmten Zusatzanforderung stand. Dazu gehören beispielsweise eine zuverlässige Fehlalarmsicherheit bei mangelnder Versorgungsspannung, Klimabeständigkeit oder elektromagnetische Verträglichkeit.
Wie viele Batterien sind nötig? Lebensdauer der Batterie
Je nach Modell muss bei einem Rauchmelder nach einiger Zeit ein Batteriewechsel vorgenommen werden. Meist gehören herkömmliche Alkaline-Batterien zum Lieferumfang, die je nach Hersteller eine Betriebsdauer von etwa 3 Jahren besitzen. Wenn der Batteriewechsel umgangen werden soll, gibt es im Handel Rauchmelder, die eine fest verbaute Lithiumbatterie besitzen. Diese Geräte gewährleisten häufig eine Haltbarkeit von bis zu 10 Jahren. Ein Batterietausch ist während dieser Zeit nicht erforderlich und je nach Gerät auch nicht möglich.
Alarmsignal & weitere Funktionen
Die Lautstärke des akustischen Alarms sollte ausreichend sein, damit das Signal auch noch in anderen Zimmern der Wohnung gehört werden kann. Bei größeren Häusern oder Wohnungen ist zudem eine Vernetzung der Rauchmelder empfehlenswert. Manche Geräte sind mit einer blinkenden LED-Lampe ausgestattet. Insbesondere in Schlafzimmern ist dies jedoch in der Regel nicht gewünscht, da das blinkende Licht der Status-LED den Nachtschlaf stören kann. Je nach persönlichem Anspruch sind Zusatzfunktionen wie ein komfortabler Nachtmodus oder die Möglichkeit zur Stummschaltung sinnvoll. Für versierte Heimwerker stellt es sicher keine große Herausforderung dar, wenn für die Befestigung des Rauchmelders die Bohrmaschine eingesetzt werden muss. Meist können die Geräte jedoch deutlich einfacher per Klebevorrichtung befestigt werden.
Installation: Wie montiere ich einen Rauchmelder richtig?
Beim Kauf der Rauchmelder ist auch die Anzahl der benötigten Geräte wichtig. Nach den Vorgaben der Rauchmelderpflicht ist die Installation von Rauchmeldern in folgenden Räumen erforderlich:
- Schlafzimmer
- Kinderzimmer
- Flure

In einigen Bundesländern wie beispielsweise Berlin und Brandenburg verlangt die jeweilige Verordnung zusätzlich die Montage eines Rauchmelders in jedem Aufenthaltsraum. Dazu zählen auch Arbeitszimmer, Wohnzimmer oder ein Hobbyraum. Küche und Bad sind von der Verpflichtung ausgenommen, da es aufgrund der Dampfentwicklung (Kocheinsatz, Dusche, etc.) bei herkömmlichen Rauchmeldern zu häufigen Fehlalarmen kommen würde. Hier können alternativ küchentaugliche Rauchmelder oder Hitzemelder für zusätzliche Sicherheit sorgen. Bei der Montage ist es wichtig, dass im Umkreis von etwa 50 Zentimeter keine Hindernisse wie Möbel oder Vorhänge die Funktionalität des Rauchmelders stören können. Der Mindestabstand zur nächsten Wand beträgt ebenfalls 50 Zentimeter. Da Rauch immer nach oben steigt, werden die Rauchmelder an der Decke befestigt. Die Befestigung sollte möglichst zentral in der Mitte des Raumes erfolgen. In allen Fluren, die als potenzielle Rettungswege gelten, ist die Montage von Rauchmeldern ebenfalls unbedingt notwendig.
Wartung des Rauchmelders
Damit ein Rauchmelder uneingeschränkt funktionieren kann und im Brandfall frühzeitig Alarm schlägt, ist von Zeit zu Zeit eine Wartung erforderlich. Nach den Vorgaben der Anwendungsnorm DIN 14676 sollten Rauchmelder daher mindestens einmal pro Jahr gewartet werden. Je nach Modell und/oder Hersteller können die empfohlenen Wartungsintervalle durchaus variieren, entsprechende Angaben sind in der Regel in den Gebrauchsanleitungen notiert. Bei der Wartung können mögliche Defekte frühzeitig erkannt und behoben werden. Sind beispielsweise die Raucheinlassöffnungen verschmutzt, kann dies im Ernstfall dazu führen, dass kein Rauch in die Messkammer gelangt und somit auch kein Alarm ausgelöst wird. Im Notfall wäre der Rauchmelder somit nicht einsatzbereit. Verschmutzungen durch tote Insekten und Staub können nach längerer Zeit zudem zu häufigen Fehlalarmen führen. Durch die Wartungen kann dies effektiv verhindert und die Funktionalität somit zuverlässig gewährleistet werden.
Die einzelnen Schritte der Wartung
Die Raucheinlassöffnungen sollten bei allen Rauchmeldern mit einem feuchten Tuch von Staub und Schmutz befreit werden. Bei der Erledigung dieser Aufgabe kann das Gerät gleichzeitig auch auf sichtbare Beschädigungen wie Kratzer oder Risse überprüft werden. Anschließend wird durch die Sichtkontrolle überprüft, ob im Umkreis von etwa 50 Zentimeter keine Gegenstände (Möbel, etc.) die Funktion einschränken. Falls nach der Installation des Melders die Möbel umdekoriert wurden und sich jetzt Hindernisse zu nahe am Rauchmelder befinden, muss das Gerät neu positioniert werden. Dies kann auch dann der Fall sein, wenn die Nutzung eines Raumes verändert wird. Bei der Wartung muss immer berücksichtigt werden, dass die Vorgaben der Anwendungsnorm DIN 14676 erfüllt sind.
Nach der Reinigung und der Sichtkontrolle wird ein manueller Funktionstest durchgeführt. In der Gerätenorm DIN EN 14604 wird das Vorhandensein einer Taste für den Funktionstest explizit gefordert. Wenn die Taste betätigt wird, ertönt bei einem funktionstüchtigen Rauchmelder ein Signalton. Ist dies nicht der Fall, ist eine Überprüfung der Gründe für die Funktionslosigkeit notwendig.

Bei Geräten mit austauschbarer Batterie werden einfach neue Batterien eingelegt. Ertönt der Signalton nach dem Drücken der Taste, waren die alten Batterien lediglich leer oder zu schwach. In der Regel wird dies jedoch frühzeitig bemerkt, da die meisten Geräte über einen speziellen Warnton verfügen, der die Notwendigkeit eines Batterieaustauschs akustisch anzeigt. Falls bei einem Funktionstest kein Signalton ertönt und dies nicht durch neue Batterien behoben werden kann, ist ein Austausch des Rauchmelders notwendig. Dies ist bei Geräten mit fest eingebauter Lithium-Batterie ohnehin der Fall, da hier kein Batterietausch erfolgen kann. Bei den meisten Rauchmeldern ist spätestens nach etwa 10 bis 12 Jahren ein Austausch notwendig, damit eine problemlose Funktionalität gewährleistet werden kann. Die Wartung sollte im Idealfall dokumentiert werden. Insbesondere für Mieter ist dies relevant, damit im Zweifelsfall die ordnungsgemäß eingehaltenen Wartungsintervalle nachgewiesen werden können.
Eigentümer, Mieter oder Vermieter – wer ist für den Einbau und die Wartung zuständig?
Bei selbst genutztem Wohneigentum ist der Bewohner immer selbst für die Wartung zuständig. Im Hinblick auf die Zuständigkeiten bei Mietwohnungen gibt es je nach Bundesland jedoch unterschiedliche Regelungen, die in den jeweiligen Landesbauordnungen verankert sind:
| Bundesland | Zuständigkeit EINBAU | Zuständigkeit WARTUNG |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Eigentümer | Mieter |
| Bayern | Eigentümer | Mieter |
| Berlin | Eigentümer | Mieter |
| Brandenburg | Eigentümer | Eigentümer |
| Bremen | Eigentümer | Mieter |
| Hamburg | Eigentümer | Eigentümer |
| Hessen | Eigentümer | Mieter |
| Mecklenburg-Vorpommern | Eigentümer | Eigentümer |
| Niedersachsen | Eigentümer | Mieter |
| Nordrhein-Westfalen | Eigentümer | Mieter |
| Rheinland-Pfalz | Eigentümer | Eigentümer |
| Saarland | Eigentümer | Eigentümer |
| Sachsen | Eigentümer | Mieter |
| Sachsen-Anhalt | Keine Regelung | Keine Regelung |
| Schleswig-Holstein | Eigentümer | Keine Regelung |
| Thüringen | Eigentümer | Eigentümer |
Wenn ein Eigentümer die Wartungspflicht auf einen Mieter überträgt, bleibt die Sekundärhaftung des Vermieters uneingeschränkt bestehen. Dies bedeutet, dass die Verpflichtung zur Wartung nur dann rechtmäßig auf den Mieter übertragen werden kann, wenn die betreffende Person in physischer und psychischer Hinsicht zur Wartungsdurchführung in der Lage ist. Die Anschaffungskosten kann der Vermieter den Mietern in Rechnung stellen, da die Ausstattung mit Rauchmeldern als Modernisierungsmaßnahme angesehen werden kann (siehe § 559 BGB). Die Kosten für Wartungsarbeiten an den Rauchmeldern werden als Betriebskosten abgerechnet.
Tipp für Mieter
In den meisten Bundesländern ist der Eigentümer oder Vermieter für die Wartung zuständig, diese Aufgabe kann jedoch durchaus delegiert werden. Wenn die Wartung durch einen Hausmeisterservice oder ein anderes Unternehmen übernommen wird, kann der Vermieter diese Kosten auf den/die Mieter umlegen. Diese Kosten können von den Mietern eingespart werden, wenn sie die Wartungsarbeiten selbst durchführen. Es ist jedoch in jedem Fall ratsam, diese Verantwortung für die Wartung unbedingt im Mietvertrag zu notieren.
Fehlalarm beim Rauchmelder vermeiden
Wer die Wartung des Rauchmelders vernachlässigt, riskiert einen Fehlalarm. Manchmal liegt es einfach nur an einer Batterie, die ausgetauscht werden muss. Dies zeigen viele Rauchmelder mit einem Signalton an, der dem Alarm recht ähnlich ist. Mitunter tritt diese Situation gerade dann auf, wenn keiner der Bewohner zu Hause ist. Besorgte Nachbarn vermuten dann einen Brand und alarmieren die Feuerwehr. Andere Ursachen für Fehlalarme beim Rauchmelder sind:
- Koch- oder Wasserdampf aus Küche und Bad, der in den Rauchmelder eindringt.
- Staub, der durch Renovierungsarbeiten entsteht und „in der Luft liegt“
- Falsche Montage des Rauchmelders
Der Rauch einer Zigarette oder der Rauch von Kerzen, die ausgeblasen wurden, sind dagegen kaum die Ursache für einen Fehlalarm. Moderne und hochwertige Rauchmelder, die Verbraucher auf dem Markt finden, sind in der Regel so eingestellt, dass sie diese Form von Rauch tolerieren. Insgesamt lohnt es sich, beim Kauf eines Rauchmelders auf Qualität zu achten. Das Gerät sollte Qualitätsmerkmale wie Prüfsiegel, Verschmutzungskompensation und eine 10-Jahre-Lithium-Batterie aufweisen. Gute, qualitätsgeprüfte Rauchmelder sind so konstruiert, dass Fehlalarme so gut wie nie auftreten. Welche Folgen ein Rauchmelder-Fehlalarm haben kann, erklärt das folgende Video:
Der Rauchmelder schlägt an: Was tun?
Die Installation von Rauchmeldern ist der erste Schritt für mehr Sicherheit. Doch die Geräte alleine reichen längst nicht aus, wenn das richtige Verhalten bei Ertönen des Signaltones nicht bekannt ist. In erster Linie sollten Verbraucher mit den Alarmtönen vertraut sein, damit sie den Unterschied zwischen echtem Alarm und der Meldung einer leeren Batterie heraushören können und es nicht zu unüberlegten Panikreaktionen kommt. Im Ernstfall entscheiden oft wenige Minuten über Leben und Tod, daher ist das richtige Verhalten ein potenzieller Lebensretter. Panik sollte in jedem Fall vermieden werden, da dies zu unüberlegten Handlungen verleiten kann. Das Motto lautet daher – Ruhe bewahren!
In Sicherheit bringen
Die Fluchtwege sollten immer frei zugänglich sein, damit im Ernstfall die Flucht nicht unnötig behindert wird. Wenn es brennt, sollten alle Personen unverzüglich die Wohnung verlassen. Falls bereits Rauchentwicklung erfolgt ist, sollten sich die Flüchtenden möglichst in Bodennähe aufhalten und notfalls sogar kriechend die Flucht ergreifen. Dies ist daher durchaus sinnvoll, da die giftigen Rauchgase nach oben steigen und sich unter der Decke sammeln. Bei mehrstöckigen Gebäuden sollte in jedem Fall die Flucht nach unten erfolgen.
Wenn es brennt, ist die Nutzung von Aufzügen absolut tabu!
Im Freien sollte ausreichend Abstand zum brennenden Gebäude eingehalten werden. Falls das Treppenhaus brennt oder durch starke Rauchgasentwicklung dieser Ausweg versperrt ist, empfehlen die Feuerwehren, unbedingt in der Wohnung zu bleiben. Das Abdichten von Türspalten mit nassen Tüchern verhindert das Eindringen von Rauch. Anschließend sollten sich die eingesperrten Personen auf dem Balkon oder am Fenster bemerkbar machen, damit die Feuerwehr auf sie aufmerksam wird und die Rettung einleiten kann.
Feuer löschen
Ein Löschversuch ist nur dann empfehlenswert, wenn es sich um einen begrenzten Brand handelt. Zudem sollte der richtige Umgang mit einem vorhandenen Feuerlöscher bekannt sein, damit es nicht zu Verzögerungen oder falscher Handhabung kommt. Es ist unbedingt erforderlich, dass ein ausreichender Abstand zum Brandherd eingehalten wird. Ebenfalls empfehlenswert ist der Einsatz mehrerer Feuerlöscher. Das Löschmittel sollte in kurzen Stößen direkt auf den Brand gesprüht werden. Bei Fettbränden in Töpfen oder Pfannen sollte ein Löschversuch zur Sicherheit immer mit einer Löschdecke erfolgen. Die Bekämpfung eines größeren Feuers sollte unbedingt unterlassen werden, da dies wertvolle Minuten kostet, die zur Flucht genutzt werden sollten.
Feuerwehr informieren
Bereits in der Grundschule wird den Kindern die richtige Vorgehensweise für die Meldung eines Brandes vermittelt. In der Praxis wird dies von den meisten Menschen aufgrund der Aufregung jedoch häufig nicht befolgt und es kommt zu unnötigen Verzögerungen. Aus diesem Grund ist die bewusste Auseinandersetzung mit diesem Thema besonders wichtig. Bei der Meldung sollten folgende Punkte beachtet werden:
- Feuerwehrnotruf anrufen unter 112
- WO ist der Notfall?
- WER meldet den Notfall?
- WAS ist passiert?
- WIE VIELE Verletzte/Betroffene gibt es?
- Nicht auflegen und auf mögliche Nachfragen warten!
- WAS ist passiert?
Nach der Meldung sollte sich die betreffende Person an die Anweisungen der Feuerwehr halten und in der Nähe des Unglücksortes warten. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte sollte gegebenenfalls erste Hilfe geleistet werden.
Wer hat Rauchmelder getestet?
Achtung: Hierbei handelt es sich um einen Rauchmelder-Vergleich. Wir haben die vorgestellten Produkte keinem Test unterzogen.
In der Testdatenbank der Stiftung Warentest finden sich inzwischen 37 Rauchmelder. Die Tests zeigten, dass es nicht immer das Standardmodell, sprich der klassische Stand-Alone-Melder, sein muss. Ebenso zuverlässig warnen auch Minigeräte, Funkrauchmelder oder Smart-Home-Geräte im Falle eines Brands. Lediglich zwei Testmodelle fielen im Test durch.
Der letzte Test aus dem Jahr 2019 befasste sich mit 17 Rauchwarnmeldern mit Lithiumbatterien, darunter zwölf Standardmodelle, ein funkvernetzbarer Melder sowie vier Geräte mit Smart-Home-Anbindung. Getestet wurden die Rauchmelder unter anderem hinsichtlich der Zuverlässigkeit des Alarms. Hier wurden ihre Wirksamkeit bei Bränden, die Gefahr eines Fehlalarms, die Störung durch einen Luftzug und die Funkvernetzung überprüft. Weiterhin spielten im Test die Lautstärke des Alarms, die Robustheit und die Deklaration eine Rolle. In puncto Handhabung standen die Gebrauchs- und Montageanleitung sowie die Montage und Inbetriebnahme, aber auch die Bedienung und Funktionskontrolle im Mittelpunkt.
Sechs Testgeräte erzielten ein gutes Ergebnis. In der Rubrik der Standardmodelle teilen sich vier Rauchmelder den ersten Platz: der Brennenstuhl für 22 Euro, der Busch-Jaeger für 25 Euro, der Ei Electronics Ei650 für 24,50 Euro und der Abus GRWM30600 für 28,10 Euro, jeweils mit der Testnote 2,2. Bei den Funkrauchmeldern punkteten der Ei Electronics für 94 Euro und der Hekatron für 80 Euro, ebenfalls jeweils mit der Testnote 2,2. Unter den smarten Geräten im Test konnte der Homematic IP für 60 Euro mit der Testnote 2,4 am meisten überzeugen.
Zuverlässige Rauchmelder gibt es bereits für etwa 20 Euro. Das günstigste Testmodell (22 Euro) hat einen Durchmesser von lediglich sieben Zentimetern, ist deshalb aber keinesfalls unzuverlässiger als seine großen Brüder.
Teaserbild: © fovito / stock.adobe.com | Abb. 1: © photophonie / stock.adobe.com | Abb. 2: © Alexander Raths / stock.adobe.com